05.12.2023 | permalink
Glyphosat: Wieviel verbieten ist erlaubt?
 Herbizid im Einsatz (Foto: Chafer Machinery / flickr, Chafer Sentry, Applying Defy at 250l/ha on wheat land in Lincolnshire, bit.ly/29E6Sk4, creativecommons.org/licenses/by/2.0)
Herbizid im Einsatz (Foto: Chafer Machinery / flickr, Chafer Sentry, Applying Defy at 250l/ha on wheat land in Lincolnshire, bit.ly/29E6Sk4, creativecommons.org/licenses/by/2.0)
Wie angekündigt hat die Europäische Kommission den Herbizidwirkstoff Glyphosat vergangene Woche in der EU bis 2033 erneut zugelassen. Daraufhin äußerte das Verwaltungsgericht Aachen gestern in einem Eilverfahren, es halte das am 1.1.2024 in Kraft tretende deutsche Anwendungsverbot für glyphosathaltige Spritzmittel für rechtswidrig. Laut mehreren Quellen arbeitet das Agrarministerium daran, dieses Verbot noch im Dezember per Eilverordnung aufzuheben. Bereits gestern verlängerte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) die Zulassungen von 27 glyphosathaltigen Spritzmitteln in Deutschland bis 15.12.2024.
„Das BMEL prüft derzeit das weitere Vorgehen, um zum 1.1.2024 einen unionsrechtskonformen Zustand herzustellen und mindestens die im heutigen Recht bestehenden Einschränkungen für den Einsatz von Glyphosat fortzuschreiben“, lautet die Sprachregelung des Agrarressorts unter dem grünen Minister Cem Özdemir. Nachfragen, etwa nach einer Eilverordnung, werden nicht beantwortet. Da war der Agrarexperte des Koalitionspartners FDP vergangene Woche im Bundestag deutlicher: „Das Verbot, welches das unionsgeführte Agrarministerium mit der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung ab 2024 eingeführt hat, wird zurückgenommen“, kündigte Ingo Bodtke an. Denn anders als die Grünen ist die FDP für den Einsatz von Glyphosat und damit dafür, das von der früheren CDU-Agrarministerin Klöckner festgelegte Verbot ab 1.1.2024 wieder zu kippen.
Das Problem: Um die Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung zu ändern, muss sich erstens die Ampelkoalition einigen und zweitens der Bundesrat zustimmen. Beides ist bis zum 1. Januar offenbar nicht mehr zu schaffen. Daher schrieb das BMEL dem Verwaltungsgericht Aachen, es prüfe, ob das deutsche Glyposatverbot mit einer Eilrechtsverordnung noch vor dem 1. Januar aufgehoben werden kann. Das jedenfalls ist auf der Webseite der am Prozess beteiligten Anwaltskanzlei zu lesen. Wie das Portal table.media aus Regierungskreisen erfahren hat, muss einer solchen Eilverordnung weder das Kabinett noch der Bundesrat zustimmen. Sie solle auf sechs Monate befristet werden, um dem Agrarministerium Zeit zu geben, mit den Koalitionspartnern die Details auszuhandeln. Denn die europäische Zulassung des Wirkstoffs erlaubt den EU-Mitgliedstaaten, seine Anwendung im fertig gemischten Pestizid zum Schutz von Gesundheit und Biodiversität einzuschränken.
Diese Unterscheidung zwischen Anwendung und Zulassung ist auch der juristische Grund, warum das BVL 27 glyphosathaltige Pflanzengifte in Deutschland bis Ende 2024 zulassen kann, obwohl sie nach aktueller Rechtslage ab 1.1.24 nicht mehr eingesetzt werden dürfen. Das Inverkehrbringen, also der Verkauf der Spritzmittel in Deutschland, richte sich nach EU-Recht, erklärt ein BVL-Sprecher dem Infodienst Gentechnik auf Anfrage. Und das erlaube den Wirkstoff jetzt wieder für zehn Jahre. Diese Entscheidung der EU-Kommission sei in allen ihren Teilen verbindlich und gelte unmittelbar in jedem Mitgliedstaat, meint – laut Anwalt der beiden klagenden Landwirte – auch das Verwaltungsgericht Aachen. Die Richter hielten es für „fernliegend“, dass die Behörden Bauern unter Strafe verbieten können, Glyphosat zu spritzen, während der Wirkstoff nach höherrangigem EU-Recht erlaubt ist. Der Gerichtsbeschluss, der den Eilantrag der Landwirte dennoch aus formalen Gründen ablehnt, ist noch nicht rechtskräftig.
Doch nicht nur die Landwirte klagen. Auch Umweltorganisationen wollen sich nicht damit abfinden, dass das umstrittene Totalherbizid weiter auf europäischen Äckern versprüht werden darf. So kündigten das Pestizid-Aktions-Netzwerk PAN Europe und die österreichische Organisation Global 2000 bereits im November an, die Zulassung des Wirkstoffs Glyphosat durch die EU-Kommission vor dem EU-Gericht anzufechten. Die Behörden hätten potentielle Gefahren für Umwelt und Gesundheit nicht ausreichend berücksichtigt, begründeten sie ihren Plan. Daher verstoße die Zulassung gegen die EU-Pestizidverordnung, die dem Schutz der Gesundheit und der biologischen Vielfalt Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen einräume. Auch die deutsche Aurelia-Stiftung will gegen die jüngste Zulassung auf EU-Ebene klagen und erarbeitet derzeit eine Strategie.
Eine weitere Klage, die Aurelia am 13. September beim EU-Gericht eingereicht hatte, soll aufrechterhalten werden. Sie richtet sich gegen die Entscheidung der EU-Kommission vom Dezember 2022, Glyphosat bis 15.12.2023 vorläufig weiter zuzulassen, weil die behördlichen Prüfungen noch nicht abgeschlossen waren. Weil diese Praxis „quasi automatischer Zulassungsverlängerungen“ auch bei Dutzenden anderen Spritzmitteln üblich ist, könnte ein Urteil nach Angaben der Aurelia-Stiftung weitreichende Auswirkungen auf die Pestizidzulassung in Europa haben. [vef]
 Amtsblatt der Europäischen Union: Durchführungsverordnung (EU) 2023/2660 der Kommission zur Erneuerung der Genehmigung für den Wirkstoff Glyphosat vom 28. November 2023 (29.11.2023)
Amtsblatt der Europäischen Union: Durchführungsverordnung (EU) 2023/2660 der Kommission zur Erneuerung der Genehmigung für den Wirkstoff Glyphosat vom 28. November 2023 (29.11.2023) Übersichtsseite der Europäischen Kommission zu Glyphosat mit Links zu den aktuellen Dokumenten (englisch mit automatischer Übersetzung)
Übersichtsseite der Europäischen Kommission zu Glyphosat mit Links zu den aktuellen Dokumenten (englisch mit automatischer Übersetzung) Europäische Kommission - Erneuerung der Genehmigung für Glyphosat: Fragen und Antworten (16.11.2023)
Europäische Kommission - Erneuerung der Genehmigung für Glyphosat: Fragen und Antworten (16.11.2023) Amtsblatt der Europäischen Union: Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
Amtsblatt der Europäischen Union: Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln Rechtsanwälte Koof und Kollegen: Verwaltungsgericht bestätigt Rechtswidrigkeit des Anwendungsverbots Glyphosat-haltiger Spritzmittel ab dem 01.01.2024 gemäß §§ 1, 9 Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung (4.12.2023)
Rechtsanwälte Koof und Kollegen: Verwaltungsgericht bestätigt Rechtswidrigkeit des Anwendungsverbots Glyphosat-haltiger Spritzmittel ab dem 01.01.2024 gemäß §§ 1, 9 Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung (4.12.2023) Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit: Zulassungsende von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Glyphosat angepasst (04.12.2023)
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit: Zulassungsende von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Glyphosat angepasst (04.12.2023) Eur-Lex - Rechtssache T-565/23: Klage, eingereicht am 13. September 2023 — Aurelia Stiftung/Kommission
Eur-Lex - Rechtssache T-565/23: Klage, eingereicht am 13. September 2023 — Aurelia Stiftung/Kommission Deutscher Bundestag: Plenarprotokoll 20/141 (30.11.2023)
Deutscher Bundestag: Plenarprotokoll 20/141 (30.11.2023) Global 2000 & PAN Europe: NGOs fechten Wiederzulassung von Glyphosat vor EU-Gericht an (21.11.2023)
Global 2000 & PAN Europe: NGOs fechten Wiederzulassung von Glyphosat vor EU-Gericht an (21.11.2023) Infodienst: EU-Kommission wird Glyphosat bis 2033 zulassen (16.11.2023)
Infodienst: EU-Kommission wird Glyphosat bis 2033 zulassen (16.11.2023)
01.12.2023 | permalink
Handel kritisiert übereilte Gentechnik-Verordnung
 Die Nachfrage nach Lebensmitteln ohne Gentechnik boomt. Foto: VLOG
Die Nachfrage nach Lebensmitteln ohne Gentechnik boomt. Foto: VLOG
Die einen drücken auf die Tube, die anderen bremsen: Bereits am 11. Dezember wollen eine Reihe von EU-Agrarminister:innen sowie der Agrarausschuss des Europäischen Parlaments über die geplante Verordnung zur Regelung neuer gentechnischer Verfahren abstimmen. Andere kritisieren das Verfahren angesichts zahlreicher ungelöster Fragen als übereilt und undemokratisch - auch in der Wirtschaft. Mehrere große Handelsunternehmen und -verbände warnen vor den gravierenden Folgen der Pläne für Lebensmittelwirtschaft und -preise.
Die geplante unkontrollierte Freigabe des Großteils neuer gentechnischer Verfahren (NGT) und der damit hergestellten Lebensmittel gefährdet die Stabilität der Lebensmittelpreise und wird die Inflation erneut anheizen. Diese Warnung ist die Kernbotschaft eines offenen Briefes, den sieben Einzelhandelskonzerne und ein Handelsverband aus Deutschland und Österreich diese Woche an EU-Kommission und Europaparlament geschickt haben. Nach dem Verordnungsvorschlag der EU-Kommission müsste allein die gentechnikfreie und die biologische Lebensmittelwirtschaft die Kosten tragen, um ihre Produktionsketten gentechnikfrei zu halten, kritisieren die Supermarktketten von Rewe über Denn’s BioMarkt bis Spar (Österreich). Das widerspreche dem Verursacherprinzip und würde über die gesamte Wertschöpfungskette erhebliche finanzielle Mittel erfordern. Diese Kosten müssten weitergegeben werden und würden mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Preissteigerungen führen, warnen die Handelsunternehmen. „Eine derartige zusätzliche finanzielle Belastung sollte – gerade in Zeiten signifikant hoher Inflation – den Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht aufgebürdet werden“, schreiben sie in ihrem Brief.
Sie mahnen EU-Kommission und Parlamentarier auch, „das Potential von Patenten als Preistreiber in der Lebensmittelproduktion sehr ernst zu nehmen“. Deshalb sollte die EU-Kommission schon vor Verabschiedung des NGT-Verordnungsvorschlages prüfen, „welche Auswirkungen Patente auf NGT-Pflanzen und -Sorten auf den Saatgutmarkt hätten – bis hin zur Verwendung in der gesamten Wertschöpfungskette“. Eine Analyse im Nachhinein, „wie sie durch die Europäische Kommission für das Jahr 2026 in Aussicht gestellt wurde, wird aus unserer Sicht dieser Herausforderung jedenfalls nicht gerecht“, kritisieren die Unternehmen. Ferner fordern sie, die Wahlfreiheit für Verbraucherinnen und Verbraucher zu wahren und die Bio-Landwirtschaft weiter zu fördern, statt sie zu bedrohen.
Bedroht sieht sich die Biobranche vor allem von der Europäischen Volkspartei (EVP) der auch CDU, CSU und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angehören. Die EVP will im Europaparlament den Verordnungsvorschlag der EU-Kommission noch erweitern und alle NGT-Pflanzen auch für den Bio-Landbau zulassen. Die Kommission hatte in ihrem Vorschlag eigens aufgenommen, dass die neue Gentechnik für den Biolandbau ebenso verboten bleiben soll wie die alte Gentechnik. Sie respektierte damit, dass die europäische Bio-Bewegung sich mit überwältigender Mehrheit gegen NGT-Pflanzen ausgesprochen hatte. „Es wäre schockierend, wenn die Europaabgeordneten beschließen würden, das Verbot von NGTs in der ökologischen Produktion zu streichen“, sagte Jan Plagge, Präsident des Bio-Dachverband Ifoam Organics Europe. In einer Presseerklärung forderte er die EU-Parlamentarier und die Mitgliedstaaten gestern auf, die Entscheidung der Bio-Bewegung zu respektieren.
Auch Plagge warnte davor, NGTs von der im Gentechnikrecht verankerten Risikobewertung und Rückverfolgbarkeit auszunehmen. „Dies hätte erhebliche Folgen für die Lebensmittelproduktion in Europa, die weit über den Bio-Markt hinausgehen“, so der Verbandschef. Deshalb sollten diese Diskussionen nicht überstürzt werden, weder im Europäischen Parlament noch unter den Mitgliedstaaten im Rat. Doch noch sieht die Planung so aus: Der Agrarministerrat soll auf seiner Sitzung am 10. und 11. Dezember über seine Position abstimmen (im Verfahrensdeutsch: allgemeine Ausrichtung). Im Vorfeld sollen die ständigen Vertreter der EU-Mitgliedstaaten, deren Positionen zuletzt noch weit auseinanderlagen, kommende Woche weiter an Kompromisslinien arbeiten und sondieren, ob die EU-Agrarminister:innen sich mehrheitlich auf einen Verordnungsvorschlag verständigen können. Der Agrarausschuss des Europäischen Parlaments (EP) will ebenfalls am 11. Dezember eine Stellungnahme verabschieden und damit auch über den Vorschlag der EVP abstimmen, Bio zwangsweise zu gentechnifizieren. Der Umweltausschuss des EP will seinen Bericht am 11. Januar beschließen. Eine Woche später ist dann die Abstimmung im Plenum des Parlaments vorgesehen. [lf/vef]
 Der offene Brief: Führende Vertreter des Lebensmittelhandels - EU-Gesetzesvorhaben zur neuen Gentechnik darf Wahlfreiheit der Verbraucher:innen, Bio-Landwirtschaft und Preisstabilität bei Lebensmitteln nicht gefährden (28.11.2023)
Der offene Brief: Führende Vertreter des Lebensmittelhandels - EU-Gesetzesvorhaben zur neuen Gentechnik darf Wahlfreiheit der Verbraucher:innen, Bio-Landwirtschaft und Preisstabilität bei Lebensmitteln nicht gefährden (28.11.2023) Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V.: Handelsunternehmen für klare Gentechnik-Regeln und stabile Lebensmittelpreise (29.11.2023)
Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V.: Handelsunternehmen für klare Gentechnik-Regeln und stabile Lebensmittelpreise (29.11.2023) Ifoam Organics Europe: Policymakers should respect organic movement's choice not to use NGTs (30.11.2023)
Ifoam Organics Europe: Policymakers should respect organic movement's choice not to use NGTs (30.11.2023) Video of the Press conference: New genomic techniques - Solid legislation takes a democratic debate, no rushed process (30.11.2023 - YouTube)
Video of the Press conference: New genomic techniques - Solid legislation takes a democratic debate, no rushed process (30.11.2023 - YouTube) Eur-Lex Recht der Europäischen Union - Glossar: Ausschuss der Ständigen Vertreter (AStV)
Eur-Lex Recht der Europäischen Union - Glossar: Ausschuss der Ständigen Vertreter (AStV) Rat der Europäischen Union: Sitzungsmaterialien des Rats „Landwirtschaft und Fischerei“ am 10./11. Dezember 2023
Rat der Europäischen Union: Sitzungsmaterialien des Rats „Landwirtschaft und Fischerei“ am 10./11. Dezember 2023 Infodienst: EU-Staaten uneins über neue Gentechnik-Verordnung (21.11.2023)
Infodienst: EU-Staaten uneins über neue Gentechnik-Verordnung (21.11.2023) Infodienst: Europas Volkspartei will Gentechnik im Ökolandbau (25.10.2023)
Infodienst: Europas Volkspartei will Gentechnik im Ökolandbau (25.10.2023)
28.11.2023 | permalink
Studie: Gentech-Baumwolle in Indien gescheitert
 Ein Großteil der Baumwolle auf dem Weltmarkt ist gentechnisch verändert. Foto: Simone Knorr
Ein Großteil der Baumwolle auf dem Weltmarkt ist gentechnisch verändert. Foto: Simone Knorr
In einer Übersichtsarbeit haben Agrarwissenschaftler aus den USA und Italien das Scheitern von gentechnisch veränderter Bt-Baumwolle in Indien erklärt. Sie empfehlen den Landwirten, auf heimische gentechnikfreie Baumwollsaat umzusteigen und warnen davor, Bt-Baumwolle in Afrika einzuführen.
In Indien wächst auf mehr als 90 Prozent der Felder gentechnisch veränderte Bt-Baumwolle. Sie produziert ein eigenes Gift, das Schadinsekten wie den Baumwollkapselwurm töten soll. Nach der Erhebung der Agrarwissenschaftler Gutierrez, Kenmore und Ponti liegt es an dieser Gentech-Baumwolle, dass die durchschnittliche Baumwollernte pro Hektar in kaum einem Land so niedrig ist wie in Indien. Sie nennen dafür mehrere Gründe: Zum einen wird das Bt-Saatgut in weiten Reihen gesät, was den Ertrag grundsätzlich verringert. Und es braucht viel Zeit bis zur Ernte, was Schädlingen und extremen Wetterereignissen mehr Zeit lässt, die Ernte zu dezimieren. Eine Alternative dazu sehen die Autoren in gentechnikfreien Sorten, die sehr dicht ausgesät werden und schnell wachsen. Deren Erträge wären nach Angaben der Autoren potentiell doppelt so hoch. Das liege auch daran, dass sie Monate später ausgesät werden als BT-Saatgut. Zu diesem Zeitpunkt neigt sich der Lebenszyklus des Kapselbohrers bereits seinem Ende zu.
Ein weiterer Grund: Das Bt-Saatgut ist etwa viermal teurer als das kaum noch vorhandene gentechnikfreie. Da es Hybridsaaten sind, können die Landwirte daraus auch nicht selbst wieder Saatgut erzeugen. Und das Geld, das sie jedes Jahr neu für teures Saatgut ausgeben müssen, können sie nicht in Dünger oder Bewässerung investieren, was die Erträge wirkungsvoll steigern würde. Hinzu kommt, dass der Baumwollkapselwurm, eine Schmetterlingsraupe, gegen das Bt-Gift der Pflanzen schon 2008 resistent wurde. Andere Schadinsekten wie die weiße Fliege nahmen überhand, weil die Bt-Baumwolle das ökologische Gleichgewicht gestört hatte. Bereits 2012 seien wieder so viele Insektizide auf Baumwollfeldern ausgebracht worden wie vor der Einführung der Bt-Baumwolle 2002, heißt es in der Arbeit.
Auch diese Spritzgifte kosten die Bauern Geld, das sie nicht für Dünger und Wasser ausgeben können. Deren Bedeutung belegen die Autoren mit Daten aus südindischen Bundesstaaten, wo der Großteil der Baumwolle im Regenfeldbau angebaut wird. Demnach würden die durchschnittlichen Erträge mit dem Anteil an bewässerten Flächen, der Menge an Dünger pro Hektar und mit den durchschnittlichen Monsunregenfällen von Juni bis Dezember steigen. Kleinbauern, denen das Geld für Wasser und Dünger fehlt, lebten beim Anbau gentechnisch veränderter Baumwolle dementsprechend oft weit unter dem Armutsniveau.
Das Fazit der Autoren lautet, dass die indischen Landwirte in eine Tretmühle aus Pestiziden und Gentechnik gerieten, „als sie versuchten, agronomische und insektizidbedingte Schädlingsprobleme mit einer ungeeigneten Bt-Baumwoll-Hybridtechnologie zu lösen“. Eine Technologie, „die suboptimale Pflanzdichten erzwang, was zu niedrigen, stagnierenden Erträgen, zunehmender Verschuldung und Zwangsvollstreckungen führte, wobei Tausende von Landwirten im Selbstmord Zuflucht suchten“.
Diese Entwicklung fürchten die Autoren auch für afrikanische Baumwollländer, von denen Kenia oder Nigeria eigene Bt-Baumwolle entwickelt haben. Weitere Länder liebäugeln mit deren Einführung. Denn auch dort wird der größte Teil der Baumwolle von Kleinbauern im Regenfeldbau, also ohne Bewässerung, erzeugt. Innovationen könnten auch Auswirkungen haben, die den besten Interessen der Gesellschaft zuwiderlaufen, schrieben die Autoren, und weiter: „Die Bt-Hybridbaumwolle in Indien sollte zu dieser Liste hinzugefügt werden, und wir warnen vor ihrer unkritischen Einführung in Afrika.“ [lf]
21.11.2023 | permalink
EU-Staaten uneins über neue Gentechnik-Verordnung
 Die kroatische Agrarministerin Marija Vučković (re.) am Rand des Agrarrats mit ihrer slovenischen Amtskollegin Eva Knez. Foto: Europäische Union
Die kroatische Agrarministerin Marija Vučković (re.) am Rand des Agrarrats mit ihrer slovenischen Amtskollegin Eva Knez. Foto: Europäische Union
Trotz zahlreicher Differenzen über die geplante europäische Verordnung zu genomeditierten Pflanzen bleibt es Ziel der spanischen Ratspräsidentschaft, die EU-Mitgliedstaaten bis 11. Dezember zu einem Kompromiss zu führen. Das ließ der designierte spanische Agrarminister gestern dem Agrarrat in Brüssel ausrichten. Damit die EU-Länder sich auf die Herausforderungen der neuen gentechnischen Verfahren (NGT) einstellen können, schlug Kroatien vor, ihnen mindestens sieben Jahre lang zu erlauben, solche Pflanzen national zu verbieten. Fast 140 Verbände forderten die Politik auf, die geplante Verordnung komplett zu stoppen.
Auch einige EU-Staaten bremsten. Polen hielt es gar nicht für nötig, NGT-Pflanzen in einer eigenen Verordnung zu regeln. Nach Ansicht der kroatischen Agrarministerin müssen noch eine ganze Reihe von Problemen für Umwelt, Wirtschaft und menschliche Gesundheit gelöst werden, bevor man über die Verordnung abstimmen kann. Ein Kernpunkt ist dabei die Wahlfreiheit für Verbraucher:innen und Unternehmen, sich für oder gegen gentechnisch veränderte (gv) Produkte zu entscheiden, heißt es in ihrer schriftlichen Vorlage. Um diese sicherzustellen, müssten sämtliche NGT-Pflanzen angemessen gekennzeichnet und überwacht werden. Denn seien sie einmal in die Umwelt freigesetzt, wo sie sich weiter vermehren und ausbreiten, könne das irreversible Schäden verursachen. Kroatien sieht derzeit auch noch technische Grenzen, eine unbeschadete Koexistenz des gentechnikfreien mit dem Anbau von NGT-Pflanzen sicherzustellen.
Wie die Slowakei, Ungarn und Zypern plädierte auch die kroatische Amtskollegin dafür, dass die EU-Staaten weiterhin selbst entscheiden können, ob NGT-Pflanzen auf ihrem Gebiet angebaut werden dürfen oder nicht. Aktuell gibt das europäische Gentechnikrecht diese Möglichkeit. Der jüngste Kompromissvorschlag der spanischen Ratspräsidentschaft vom 10. November, der dem Infodienst Gentechnik vorliegt, sieht sie aber nicht mehr vor. Staaten wie Frankreich oder Litauen verlangten diese Option im Agrarrat zumindest für NGT-Pflanzen, bei denen eine größere Zahl von Genen verändert wurden (Kategorie 2). Gegner des sogenannten „Opt out“ wie Dänemark oder Tschechien warnten, es würde den Wettbewerb innerhalb der EU verzerren. Einen Eingriff in ihre nationale Souveränität sahen Staaten wie Ungarn und Polen auch darin, dass die EU-Kommission laut Verordnungsentwurf künftig allein regeln darf, welche NGT-Pflanzen in die privilegierte Kategorie 1 fallen und damit von Kennzeichnung und Risikoprüfung ausgenommen werden sollen (sog. delegierter Rechtsakt).
Ein großer Kritikpunkt, den der deutsche Agrarminister Cem Özdemir zumindest vor der Sitzung des Agrarrats unterstützte, ist ferner die ungeregelte Patentfrage. Neun weitere EU-Länder – vom NGT-Befürworter Niederlande bis zum Kritiker Polen – forderten in der Sitzung, die geplante Verordnung müsse sicherstellen, dass Landwirte und Züchterinnen weiterhin Zugang zu Pflanzenmaterial behalten und keine Monopole entstehen. Für Griechenland ist dieser Punkt nicht verhandelbar. Die EU-Kommission, die erneut versicherte, sie würde die Bedenken ernst nehmen, beharrt jedoch darauf, die Marktentwicklung erst einmal zu beobachten. Allenfalls könnte sie ihre geplante Evaluation schon vor 2026 vorlegen, hieß es zuletzt.
Den Einsatz von NGT noch weiter liberalisieren als der spanische Kompromissvorschlag wollen Schweden, Portugal und die Niederlande: Sie wollen es auch Biobauern erlauben, NGT-Pflanzen anzubauen, um ihnen die gleichen „Chancen“ zu geben wie der konventionellen Landwirtschaft. Dem stehen allerdings elf EU-Staaten gegenüber, die vor dem (Deutschland) oder im Agrarausschuss appellierten, den Ökolandbau vor Gentechnik zu schützen. Um es mit den Worten Kroatiens zu sagen: Es sei das „legitime Recht der Bioproduzenten“ und für die Weiterentwicklung des Sektors und das Vertrauen der Konsument:innen unerlässlich, sämtliche NGT-Pflanzen in der Bioproduktion zu verbieten.
Die zuständige EU-Gesundheitskommissarin betonte erneut, wie wichtig neue Verfahren in der Agrogentechnik für die Lebensmittelsicherheit in Europa und die Wettbewerbsfähigkeit in der Welt seien. Eine Risikobewertung nur bei komplexeren Genveränderungen vorzusehen, sei verhältnismäßig und entspreche dem Vorsorgeprinzip, sagte Stella Kyriakides. Sie hoffe, vor den Europawahlen im Juni 2024 zu einer Einigung zu kommen. Die spanische Ratspräsidentschaft will zunächst im Agrarrat am 11.12. eine sogenannte „allgemeine Ausrichtung“ beschließen, bevor im Januar dann Belgien Ratspräsident wird. Eine solche „allgemeine Ausrichtung“ (engl: general approach) dient einem beschleunigten Gesetzgebungsverfahren, indem das Europäische Parlament bereits vor seiner eigenen Entscheidung im Januar die Eckpunkte der zu erwartenden Ratsposition erfährt. Ziel ist, dass sich Rat, Parlament und Kommission im anschließenden Trilog schneller einigen.
Einigen EU-Staaten geht das angesichts des großen Diskussionsbedarfs zu schnell. So verwies Polen im Agrarrat darauf, dass die Beschleunigung des Verfahrens nicht dazu beitrage, die offenen Fragen zu klären. Auch Deutschland und Österreich forderten, auf Qualität statt auf Tempo zu setzen. Mehrere EU-Staaten betonten, wie groß das öffentliche Interesse an der Agrogentechnik sei, unter anderem weil eine große Mehrheit der Menschen laut Umfragen keine Gentechnik auf ihren Tellern will. Gerade gestern hatten Agrar- und Umweltorganisationen den deutschen Agrarminister Özdemir in einem offenen Brief erneut aufgefordert, den Verordnungsvorschlag zur neuen Gentechnik abzulehnen.
Sie bezogen sich dabei auf ein Positionspapier von fast 140 Organisationen und Verbänden aus den unterschiedlichsten Bereichen, die alle ein Ziel eint: Sämtliche NGT-Pflanzen sollen auch in Zukunft umfassend auf ihre Risiken geprüft und gekennzeichnet werden. Verbraucherinnen sollen ihre Wahlfreiheit ebenso behalten wie Hersteller und Landwirte. Wie einige EU-Staaten fordern die Organisationen Nachweisverfahren und ein öffentliches Register für solche Pflanzen. „Bitte sorgen Sie … dafür, dass die deutsche Land- und Ernährungswirtschaft auch in Zukunft ihren großen Wettbewerbsvorteil einer gentechnikfreien Erzeugung behalten kann, die Wahlfreiheit der Verbraucher*innen erhalten, das Vorsorgeprinzip gestärkt und die Umwelt geschützt wird“, heißt es im Brief an den deutschen Agrarminister. In der Hoffnung, dass er sich im Dezember auch während der Sitzung des Agrarrats gegen die Verordnung aussprechen wird und nicht nur vor der Tür. [vef]
Korrektur: Der Agrarrat will am 11.12. und nicht am 12.12. über den NGT-Kompromissvorschlag der spanischen Ratspräsidentschaft abstimmen. Die zweitägige Sitzung beginnt bereits am Sonntag, 10.12.2023.
 Rat der Europäischen Union: Tagungsseite des Rates „Landwirtschaft und Fischerei“ am 20.11.2023
Rat der Europäischen Union: Tagungsseite des Rates „Landwirtschaft und Fischerei“ am 20.11.2023 Council of the European Union - Regulation of the European Parliament and of the Council on plants obtained by certain new genomic techniques (EU) 2017/625 - Information from the Presidency on the state of play 15301/23 (14.11.2023)
Council of the European Union - Regulation of the European Parliament and of the Council on plants obtained by certain new genomic techniques (EU) 2017/625 - Information from the Presidency on the state of play 15301/23 (14.11.2023) Council of the European Union: Regulation on plants obtained by certain new genomic techniques and their food and feed products
Council of the European Union: Regulation on plants obtained by certain new genomic techniques and their food and feed products
- Information from the Croatian delegation (15.11.2023) Video der Debatte im EU-Agrarrat zum NGT-Kompromissvorschlag der spanischen Ratspräsidentschaft am 20.11.2023
Video der Debatte im EU-Agrarrat zum NGT-Kompromissvorschlag der spanischen Ratspräsidentschaft am 20.11.2023 Agriculture and Fisheries Council: Doorstep by Cem Özdemir, Federal Minister of Food and Agriculture of Germany (Video, 20.11.2023)
Agriculture and Fisheries Council: Doorstep by Cem Özdemir, Federal Minister of Food and Agriculture of Germany (Video, 20.11.2023) Rat der Europäischen Union: Die Beschlussfassung im Rat (Erklärseite)
Rat der Europäischen Union: Die Beschlussfassung im Rat (Erklärseite) Medieninfo: 139 Verbände fordern strikte Regulierung von Gentechnik plus offener Brief an Bundesminister Özdemir (20.11.2023)
Medieninfo: 139 Verbände fordern strikte Regulierung von Gentechnik plus offener Brief an Bundesminister Özdemir (20.11.2023) Internationaler Verbändeappell von Greenpeace u.a. - Risiko für Zukunft unseres Saatguts: Zivilgesellschaft schlägt Alarm bei EU-Agrarminister:innen (17.11.2023)
Internationaler Verbändeappell von Greenpeace u.a. - Risiko für Zukunft unseres Saatguts: Zivilgesellschaft schlägt Alarm bei EU-Agrarminister:innen (17.11.2023) Europäische Kommission: Vorschlag für eine
Europäische Kommission: Vorschlag für eine
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rats über mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/625 (05.07.2023) Infodienst: Europas Volkspartei will Gentechnik im Ökolandbau (25.10.2023)
Infodienst: Europas Volkspartei will Gentechnik im Ökolandbau (25.10.2023) Infodienst - Neue Gentechnik: viel Kritik am Kommissionsentwurf im Agrarrat (27.07.2023)
Infodienst - Neue Gentechnik: viel Kritik am Kommissionsentwurf im Agrarrat (27.07.2023)
16.11.2023 | permalink
EU-Kommission wird Glyphosat bis 2033 zulassen
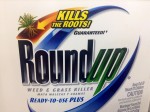 RoundUp von Bayer/Monsanto (Foto: Mike Mozart, bit.ly/2yIfwuQ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
RoundUp von Bayer/Monsanto (Foto: Mike Mozart, bit.ly/2yIfwuQ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
Die Europäische Kommission wird den Herbizid-Wirkstoff Glyphosat im Alleingang für weitere zehn Jahre, also bis Ende 2033, in der EU zulassen. Das teilte sie heute mit, nachdem die 27 EU-Mitgliedstaaten diesen Vorschlag auch im zweiten Versuch nicht mit qualifizierter Mehrheit befürwortet oder abgelehnt hatten. Nun droht der Bundesregierung nach Einschätzung von Rechtsexperten das Problem, dass das ab 1.1.2024 gültige Verbot glyphosathaltiger Spritzmittel in Deutschland kollidiert mit der Zulassung des Wirkstoffs nach europäischem Recht.
Wie erwartet hat in der heutigen Sitzung des Berufungsausschusses zwar wieder eine Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten für den Zulassungsvorschlag der Kommission gestimmt. Die 17 Länder repräsentierten jedoch keine qualifizierte Mehrheit von 55 Prozent der Mitgliedstaaten und 65 Prozent der Bevölkerung der EU. Wie der Europaabgeordnete Martin Häusling twitterte, stimmten die Mitgliedstaaten fast genauso ab wie bei der ersten Sitzung im Oktober, lediglich Italien schwenkte von Zustimmung auf Enthaltung um. Ebenfalls enthalten hatten sich demnach Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Bulgarien, Belgien und Malta. Österreich, Luxemburg und Kroatien lehnten eine erneute Zulassung des Unkrautvernichters ab. Bundesagrarminister Cem Özdemir bedauerte im Anschluss, dass der Dissens in der Koalition ihn zu einer Enthaltung gezwungen habe. „Ich hätte gerne gemäß unserer Koalitionsvereinbarung mit einem klaren ‚Nein‘ gestimmt“, so der grüne Minister. Die Neuzulassung hätte er aber auch damit nicht stoppen können.
Unmittelbar nach dieser Sitzung teilte die EU-Kommission mit: „Auf der Grundlage umfassender Sicherheitsbewertungen, die von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) und der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) zusammen mit den EU-Mitgliedstaaten durchgeführt wurden, wird die Kommission nun die Zulassung von Glyphosat für einen Zeitraum von zehn Jahren verlängern, wobei bestimmte neue Bedingungen und Einschränkungen gelten“. Konkret nannte sie ein Verbot der Sikkation, also das Abspritzen erntereifer Felder mit Glyphosat, um die Ernte zu erleichtern. Auch will sie maximale Mengen festlegen, wieviel von dem Totalherbizid auf den Feldern ausgebracht werden darf. Dass die Umwelt geschützt und Wildblumen oder kleine Säugetieren wie Wühlmäuse nicht geschädigt werden, dafür sollen die Mitgliedstaaten in ihren Vorschriften für den Spritzmitteleinsatz sorgen, schrieb die EU-Kommission. Die EFSA soll Leitlinien entwickeln, um mögliche indirekte Auswirkungen von Glyphosat auf die Artenvielfalt bewerten zu können.
Dass es an der Stelle Datenlücken gibt, hatte die EFSA im Zulassungsprozess selbst eingeräumt. Auch ernährungsbedingte Risiken für Verbraucher:innen konnte sie nicht abschließend klären. Dass die EU-Kommission das Pflanzengift trotzdem weiter zulassen will, empört viele Umwelt- und Verbraucherorganisationen. „Zahlreiche unabhängige Studien belegen die verheerenden Konsequenzen von Glyphosat für die Artenvielfalt und auch für die menschliche Gesundheit“, warnt etwa Christine Vogt, Agrarreferentin beim Umweltinstitut München. „Wir erwarten, dass die Kommission nach dem europäischen Vorsorgeprinzip handelt und Glyphosat keine weitere Genehmigung erteilt.“ Corinna Hölzel, Pestizidexpertin beim Umweltverband BUND, fordert ein nationales Glyphosatverbot.
Nach der deutschen Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung ist es ab 1. Januar 2024 untersagt, Glyphosat weiter anzuwenden. Bereits im Juni hatte ein auf Spritzmittelzulassungen spezialisierter Rechtsanwalt jedoch darauf hingewiesen, dass Deutschland Glyphosat nicht komplett verbieten kann, wenn der Wirkstoff in Brüssel erlaubt ist. Erneuert die EU-Kommission die Glyphosat-Zulassung also wie angekündigt bis 2033, könnte das deutsche Verbot ab 1.1.2024 damit kollidieren. Auch der deutsche Agrarminister hatte bereits eingeräumt, dass das Europarecht ihm beim Verbot des Totalherbizids Grenzen setzt. Zwar schreibt die EU-Kommission, die Mitgliedstaaten könnten die Verwendung glyphosathaltiger Pestizide „auf nationaler und regionaler Ebene einschränken, wenn sie dies aufgrund der Ergebnisse von Risikobewertungen für notwendig erachten, wobei sie insbesondere die Notwendigkeit des Schutzes der biologischen Vielfalt berücksichtigen“. Ein hochrangiger Kommissionsbeamter hatte im Oktober jedoch deutlich gemacht, dass das kaum komplette Verbote rechtfertigen dürfte. Auch Rechtsanwalt Peter Koof schreibt auf seiner Webseite, dass die Bundesregierung schon längst hätte aktiv werden müssen, um die Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung zu ändern. Denn es gebe bereits jetzt diverse glyphosathaltige Pestizide, die über den 15.12.2023 hinaus zugelassen sind. Hintergrund ist, dass die EU-Kommission zwar Pestizidwirkstoffe zulassen kann. Die europäischen Mitgliedstaaten regeln aber selbst, welche Spritzmittel mit welchen Wirkstoffen in ihren Hoheitsgebieten erlaubt sind.
Was Glyphosat angeht, sieht Agrarminister Özdemir hier offenbar keinen Zeitdruck: Sein Ministerium werde „nun sehr genau prüfen, …welche nationalen Handlungsmöglichkeiten wir haben, um den Koalitionsvertrag so weit wie möglich umzusetzen“, teilte er heute mit. Im Koalitionsvertrag hatten die Ampel-Parteien festgehalten: «Wir nehmen Glyphosat bis Ende 2023 vom Markt.» Zur Frage, wie man dabei mit dem Widerspruch zwischen der EU-Zulassung und der deutschen Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung umzugehen gedenkt, konnte der Infodienst Gentechnik trotz mehrfacher Nachfragen beim BMEL seit Sommer bislang keine Antwort erhalten. Für Rechtsanwalt Peter Koof ist die Sache klar: „Das Anwendungsverbot für glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel ab dem 01.01.2024 ist erst recht aufzuheben, wenn die Genehmigung des Wirkstoffs Glyphosat von der Europäischen Kommission über den 15.12.2023 hinaus verlängert wird“, schrieb er schon im Juni.
Bestätigt sieht er seine Auffassung durch ein Urteil des luxemburgischen Verwaltungsgerichtshofs vom März diesen Jahres. Als erstes EU-Mitglied hatte Luxemburg im Januar 2021 Glyphosat landesweit verboten. Das Gericht hob das Verbot jedoch auf, da es keine besonderen ökologischen oder landwirtschaftlichen Merkmale in Luxemburg gebe, die ein nationales Verbot rechtfertigten. Es liegt also auf der Hand, dass auch das Glyphosat-Verbot aus der deutschen Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung 2024 vor Gericht landen wird. Doch auch die Gegner des Spritzmittels ziehen vor Gericht. So klagt die Deutsche Umwelthilfe gegen das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, weil es den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup PowerFlex zugelassen habe, ohne die negativen Auswirkungen auf den Artenschutz ausreichend zu berücksichtigen. DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch kündigte bereits weitere Klagen gegen glyphosathaltige Pestizide an. In Frankreich hatte eine Umweltorganisation mit einer solchen Klage Erfolg. Wie es aussieht werden also die Gerichte ausbügeln müssen, was die Politik unzureichend geregelt hat. [lf/vef]
 Europäische Kommission: Mitgliedstaaten konnten sich nicht mit qualifizierter Mehrheit auf die Erneuerung bzw. Nichterneuerung der Genehmigung für Glyphosat einigen (mit Link zu Fragen und Antworten - 16.11.2023)
Europäische Kommission: Mitgliedstaaten konnten sich nicht mit qualifizierter Mehrheit auf die Erneuerung bzw. Nichterneuerung der Genehmigung für Glyphosat einigen (mit Link zu Fragen und Antworten - 16.11.2023) Tweet MdEP Martin Häusling zum Abstimmungsverhalten der EU-Mitgliedstaaten (16.11.2023)
Tweet MdEP Martin Häusling zum Abstimmungsverhalten der EU-Mitgliedstaaten (16.11.2023) Übersichtsseite der Europäischen Kommission zu Glyphosat mit Links zu den aktuellen Dokumenten (englisch mit automatischer Übersetzung)
Übersichtsseite der Europäischen Kommission zu Glyphosat mit Links zu den aktuellen Dokumenten (englisch mit automatischer Übersetzung) Pressemitteilung BMEL: Erneut keine Mehrheit für Glyphosat-Genehmigung - Özdemir kritisiert mögliche Zulassung für weitere zehn Jahre durch EU-Kommission (16.11.2023)
Pressemitteilung BMEL: Erneut keine Mehrheit für Glyphosat-Genehmigung - Özdemir kritisiert mögliche Zulassung für weitere zehn Jahre durch EU-Kommission (16.11.2023) Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft: Fragen und Antworten zu Glyphosat
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft: Fragen und Antworten zu Glyphosat Deutsche Umwelthilfe: Bayer-Ultragift Glyphosat - Deutsche Umwelthilfe fordert Landwirtschaftsminister Özdemir auf, klar gegen eine weitere Verlängerung der Zulassung zu stimmen (14.11.2023)
Deutsche Umwelthilfe: Bayer-Ultragift Glyphosat - Deutsche Umwelthilfe fordert Landwirtschaftsminister Özdemir auf, klar gegen eine weitere Verlängerung der Zulassung zu stimmen (14.11.2023) BUND-Kommentar von Corinna Hölzel: EU-Entscheidung zu Glyphosat: Brüssel geht einen falschen Weg (16.11.2023)
BUND-Kommentar von Corinna Hölzel: EU-Entscheidung zu Glyphosat: Brüssel geht einen falschen Weg (16.11.2023) Medieninfo Umweltinstitut München - Glyphosat: EU-Kommission findet wieder keine Mehrheit für weitere Genehmigung (16.11.2023)
Medieninfo Umweltinstitut München - Glyphosat: EU-Kommission findet wieder keine Mehrheit für weitere Genehmigung (16.11.2023) Rechtsanwälte Koof und Kollegen: Anwendungsverbot für glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel ab dem 01.01.2024 in Deutschland (26.06.2023)
Rechtsanwälte Koof und Kollegen: Anwendungsverbot für glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel ab dem 01.01.2024 in Deutschland (26.06.2023) Infodienst - Glyphosat: Zulassung trotz Leukämieverdachts? (15.11.2023)
Infodienst - Glyphosat: Zulassung trotz Leukämieverdachts? (15.11.2023) Infodienst: Glyphosat: Behörde verlängert Spritzmittelzulassungen ungeprüft (12.12.2018)
Infodienst: Glyphosat: Behörde verlängert Spritzmittelzulassungen ungeprüft (12.12.2018)
15.11.2023 | permalink
Glyphosat: Zulassung trotz Leukämieverdachts?
 Herbizid im Einsatz (Foto: Chafer Machinery / flickr, Chafer Sentry, Applying Defy at 250l/ha on wheat land in Lincolnshire, bit.ly/29E6Sk4, creativecommons.org/licenses/by/2.0)
Herbizid im Einsatz (Foto: Chafer Machinery / flickr, Chafer Sentry, Applying Defy at 250l/ha on wheat land in Lincolnshire, bit.ly/29E6Sk4, creativecommons.org/licenses/by/2.0)
+++UPDATE+++ Die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) werden wohl morgen, am 16.11., darüber entscheiden, ob der Unkrautvernichter Glyphosat weitere zehn Jahre auf hiesigen Äckern versprüht werden darf. In einer aktuellen Langzeitstudie mit Ratten haben Herbizide mit diesem Wirkstoff in mehreren Fällen Leukämie ausgelöst. Und zwar in Dosierungen, die bisher von den Genehmigungsbehörden für unbedenklich gehalten wurden. Grund genug, die Notbremse zu ziehen?
Seit mehreren Jahren arbeitet das italienische Ramazzini Institut zusammen mit mehreren internationalen Forschungseinrichtungen an einer umfassenden Glyphosat-Studie, der Global Glyphosate Study (GGS). Auf einer Tagung präsentierten die Forschenden nun erste Ergebnisse. Sie zeigen, dass glyphosathaltige Unkrautvernichter Leukämie auslösen können – zumindest bei Ratten. Die Tiere erhielten zwei Jahre lang täglich entweder den reinen Wirkstoff oder ein glyphosathaltiges Herbizid. Verwendet wurden dabei das in Europa zugelassene Spritzmittel Roundup BioFlow oder das in den USA eingesetzte Ranger Pro. Verschiedene Tiergruppen erhielten von den Substanzen über das Trinkwasser jeweils 0,5, 5 oder 50 Milligramm je Kilogramm Körpergewicht und Tag. Die Menge von 50 Milligramm entspricht der Konzentration, bei der nach Angaben der EU-Lebensmittelbehörde EFSA in Tierversuchen mit Glyphosat bisher keine negativen Effekte beobachtet wurden. Abgeleitet davon gilt in der EU die Menge von 0,5 Milligramm Glyphosat je Kilogramm Körpergewicht als akzeptable tägliche Aufnahme durch den Menschen.
In der Studie erkrankten in der Versuchsgruppe, die 0,5 Milligramm reines Glyphosat pro Kilo Gewicht erhielt, zwei von 102 Tieren an Leukämie. In den Gruppen mit 5,0 und 50 Milligramm war es jeweils eins von 102 Tieren. Beim Spritzmittel Ranger Pro waren es in den drei Gruppen eins, zwei und vier Tiere; bei Roundup traten in der 50 Milligramm-Gruppe drei Leukämiefälle auf. Als besonders bedenklich bezeichnete es Studienkoordinator Daniele Mandrioli, dass bei der höchsten Dosierung die meisten Fälle schon im ersten Lebensjahr der Tiere auftraten. „Diese Ergebnisse sind von so großer Bedeutung für die öffentliche Gesundheit, dass wir beschlossen haben, sie jetzt … zu präsentieren. Die vollständigen Daten werden in den kommenden Wochen öffentlich zugänglich gemacht und zur Veröffentlichung in einer wissenschaftlichen Zeitschrift eingereicht“, sagte Mandrioli.
Einfließen könnten diese Ergebnisse in die anstehende Entscheidung über die erneute Zulassung von Glyphosat in der EU. Am 16. November stimmen die EU-Mitgliedstaaten im Berufungsausschuss über den Vorschlag der EU-Kommission ab, das Totalherbizid für weitere zehn Jahre zu erlauben. Dieser Termin wurde notwendig, weil es im Oktober im zuständigen Ausschuss (ScoPAFF) keine qualifizierte Mehrheit für diesen Vorschlag gab. In einer Zusammenfassung der damaligen Diskussion schreibt die EU-Kommission, die meisten Mitgliedstaaten hätten sich eine Neuzulassung sogar für 15 Jahre gewünscht. Doch eine qualifizierte Mehrheit, bestehend aus 55 Prozent der Mitgliedsstaaten die gleichzeitig 65 Prozent der EU-Bevölkerung vertreten, kam nicht einmal für den Zehn-Jahres-Vorschlag zustande. Wie berichtet hatten Österreich, Luxemburg und Kroatien dagegen gestimmt; Frankreich und Deutschland sowie Bulgarien, Belgien, Malta und die Niederlande hatten sich enthalten.
Ob diese blockierende Minderheit erhalten bleiben wird, wird wesentlich vom Abstimmungsverhalten Frankreichs abhängen. Das Land hatte seine Enthaltung im Oktober damit begründet, dass Glyphosat nur in Fällen angewendet werden sollte, in denen es keine Alternativen gebe. Diese Regelung dürfe die Kommission nicht auf die Mitgliedstaaten verlagern. Wie topagrar berichtet, soll der Kommissionsvorschlag morgen unverändert abgestimmt werden. In diesem Fall, so sagte der französische Agrarminister heute dem Sender "France info", gebe es für Frankreich auch keinen Grund, anders abzustimmen als beim ersten Mal.
Deutschland wird einer weiteren Zulassung nach Angaben einer Sprecherin wieder nicht zustimmen. Angesichts des anhaltenden Dissenses in der Ampelkoalition zu dem Thema dürfte es also erneut auf eine Enthaltung hinauslaufen. Das trug dem grünen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir bereits reichlich Kritik ein, zuletzt vom Bio-Dachverband BÖLW. Auf einer Branchentagung vergangene Woche forderte die BÖLW-Vorstandsvorsitzende Tina Andres das Ministerium auf, bei wichtigen Themen wie Glyphosat und Gentechnik auf europäischer Ebene nicht stumm zu bleiben, sondern Haltung zu zeigen.
Da es damit im Berufungsausschuss wohl weder für noch gegen den Plan der EU-Kommission eine qualifizierte Mehrheit geben wird, wird diese Glyphosat voraussichtlich alleine bis 2033 zulassen. Bis zum 15. Dezember muss eine Entscheidung fallen, da dann die geltende Zulassung ausläuft. Das EU-Parlament (EP) kann dazu nur Empfehlungen aussprechen und ist zudem selber uneins. Im Umweltausschuss des EP scheiterten im Oktober sowohl eine Resolution, die die Kommission aufforderte, Glyphosat weiter zu genehmigen, als auch eine, die verlangte, es nicht erneut zuzulassen. Das europäische Pestizidaktionsnetzwerk PAN und andere Umweltorganisationen forderten die EU-Kommission auf, angesichts der vorgelegten Leukämie-Studie ihren Zulassungsvorschlag zurückzuziehen. „Diese qualitativ hochwertige Studie bedarf der vollen Aufmerksamkeit der europäischen Behörden, da sie alarmierende neue Beweise liefert, die frühere Erkenntnisse über die krebserregende Wirkung von Glyphosat im Lymphsystem bestätigen, die in Studien an Mäusen und in epidemiologischen Studien am Menschen festgestellt wurden“, sagte der Toxikologe Peter Clausing für PAN. [lf/vef]
Update: aktuelles Statement Frankreichs
 Die Präsentation des Ramazzini Instituts: Global Glyphosate Study: First Results from the Long-term Integrated Study (25.10.2023)
Die Präsentation des Ramazzini Instituts: Global Glyphosate Study: First Results from the Long-term Integrated Study (25.10.2023) Ramazzini Institut: Global Glyphosate Study Reveals Glyphosate-Based Herbicides Cause Leukemia in Early Life (25.10.2023)
Ramazzini Institut: Global Glyphosate Study Reveals Glyphosate-Based Herbicides Cause Leukemia in Early Life (25.10.2023) EU-Kommission: Discussion at the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (PAFF
EU-Kommission: Discussion at the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (PAFF
Committee), section Phytopharmaceuticals - Legislation on Agenda item B.03.00, 12.-13.10. 2023, Summary Report. Pesticide Action Network Europe: Glyphosate-based herbicides linked to leukemia at a young age, in major new research (25.10.2023)
Pesticide Action Network Europe: Glyphosate-based herbicides linked to leukemia at a young age, in major new research (25.10.2023) topagrar: Neuer Anlauf für Glyphosat am Donnerstag (14.11.2923)
topagrar: Neuer Anlauf für Glyphosat am Donnerstag (14.11.2923) Infodienst: Glyphosat - EU-Staaten stoppen Genehmigung nicht (13.10.2023)
Infodienst: Glyphosat - EU-Staaten stoppen Genehmigung nicht (13.10.2023) Tagesspiegel Background, Standpunkt Christine Vogt (UIM) - Glyphosat-Verbot: Warum schweigt die SPD? (13.11.2023)
Tagesspiegel Background, Standpunkt Christine Vogt (UIM) - Glyphosat-Verbot: Warum schweigt die SPD? (13.11.2023) taz - Glyphosat-Debatte in Frankreich: Entschädigung für Missbildungen (14.11.2023)
taz - Glyphosat-Debatte in Frankreich: Entschädigung für Missbildungen (14.11.2023) Europäische Kommission: Tagesordnung Berufungsausschuss am 16.11.2023
Europäische Kommission: Tagesordnung Berufungsausschuss am 16.11.2023 Francetvinfo.fr - "Il n'y a pas de raison que le vote change": la France se dirige vers une nouvelle abstention lors de la consultation des États membres sur le glyphosate (15.11.2023)
Francetvinfo.fr - "Il n'y a pas de raison que le vote change": la France se dirige vers une nouvelle abstention lors de la consultation des États membres sur le glyphosate (15.11.2023)
09.11.2023 | permalink
Handelskonzerne gespalten bei neuer Gentechnik
 Stephen Ausmus / USDA, https://www.flickr.com/photos/usdagov/8411827143, creativecommons.org/licenses/by/2.0
Stephen Ausmus / USDA, https://www.flickr.com/photos/usdagov/8411827143, creativecommons.org/licenses/by/2.0
Würden die Regeln für Produkte neuer gentechnischer Verfahren (NGT) gemäß den Vorschlägen der Europäischen Kommission gelockert, könnten Verbraucher:innen in vielen Fällen nicht mehr feststellen, ob ein Lebensmittel gentechnisch veränderte Zutaten enthält. Das bemängelten die Handelskonzerne ALDI Nord, ALDI Süd und REWE auf Anfragen gentechnikkritischer Organisationen. Mehrheitlich begrüßte der Handelsverband Lebensmittel (BVLH) jedoch die Pläne der EU-Kommission, bestimmte NGT-Pflanzen von den Prüf- und Kennzeichnungsvorschriften des Gentechnikrechts auszunehmen.
Auf Anfrage der Aurelia-Stiftung sprachen sich ALDI Nord und ALDI Süd dafür aus, NGT-Produkte auch weiterhin als solche zu kennzeichnen, um den Kund:innen die Wahl zu lassen, ob sie Lebensmittel mit oder ohne Gentechnik kaufen wollen. Neben einer Transparenz entlang der Lieferkette spreche das Vorsorgeprinzip für eine angemessene Risikobewertung solcher Produkte, so der Discounter. „Dass mit ALDI einer der weltweit größten Discounter für Wahlfreiheit und Risikoprüfung bei Neuer Gentechnik eintritt, ist eine gute Nachricht für Menschen, Artenvielfalt und stabile Ökosysteme“, lobte Bernd Rodekohr von der Aurelia-Stiftung für die Biene. „Denn ohne einzelfallbezogene, wissenschaftsbasierte Risikoprüfung lassen sich schädliche Auswirkungen von NGT-Pflanzen mit neuen Eigenschaften für das Ökosystem nicht sicher ausschließen.“
Ähnlich hatte sich bereits im Oktober eine Vertreterin der REWE Group positioniert: „Es ist aus Sicht der REWE Group auch im Bereich der neuen gentechnischen Verfahren erforderlich, unter Verwendung dieser Techniken hergestellte Produkte einem Zulassungsverfahren einschließlich einer Risikoprüfung zu unterwerfen und die Prinzipien Rückverfolgbarkeit, Vorsorge und Kennzeichnung weiterhin zu berücksichtigen“, sagte Vorstandsmitglied Daniela Büchel anlässlich der Messe Anuga. Rechtssicherheit und Transparenz hätten oberste Priorität für ihr Unternehmen, das sowohl im BVLH auch im Vorstand des Verbands Lebensmittel ohne Gentechnik (VLOG) vertreten ist. Dessen Geschäftsführer Alexander Hissting meint, EU-Kommission und Europaparlament könnten diese wichtigen Signale der drei großen Lebensmittelhandelsunternehmen im Sinne des Verbraucherschutzes nicht ignorieren. Entgegen den Zielen der EU-Kommission im laufenden Gesetzgebungsverfahren müsse diese dafür sorgen, dass auch künftig alle Arten neuer Gentechnik umfassend gekennzeichnet werden. Der VLOG vergibt ein freiwilliges Ohne-Gentechnik-Siegel für tierische Lebensmittel, die ohne gentechnisch verändertes Futter erzeugt wurden – ein Markt mit einem Jahresumsatz von rund 16 Milliarden Euro.
Edeka und die Schwarz Gruppe (Lidl) hätten sich in der Umfrage der Aurelia-Stiftung dagegen ausgesprochen, nur minimal veränderte NGT-Pflanzen verpflichtend zu kennzeichnen und ihre Risiken für Gesundheit und Umwelt zu prüfen, bedauerte Rodekohr. Die Unternehmen beriefen sich dabei auf ein Gentechnik-Positionspapier des Branchenverbandes BVLH, das den EU-Kommissionsvorschlag unterstützt, die Regeln für NGT-Produkte zu lockern. Der Handel befürworte mit großer Mehrheit den Verordnungsvorschlag der EU-Kommission, der die rechtlichen Regeln für NGT-Produkte an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt anpassen soll, heißt es in dem Papier von Ende Oktober. Denn die wachsende Weltbevölkerung müsse ernährt werden. Die Verbraucher:innen hätten genug Wahlfreiheit, wenn – wie von der Kommission geplant – nur Produkte mit mehr als 20 gentechnischen Veränderungen gekennzeichnet würden. Skeptisch sieht der Handel jedoch, dass der Entwurf der EU-Kommission erlauben will, weitere Details dieser privilegierten Kategorie in sogenannten „delegierten Rechtsakten“, also ohne das übliche europäische Gesetzgebungsverfahren festzulegen. Das sieht nämlich vor, dass sich – wie es derzeit geschieht - Europäisches Parlament und Rat eine Meinung zu einem Vorschlag bilden, bevor sie sich im Trilog mit EU-Kommission auf eine Regelung einigen.
Kritisch sieht der Handelsverband Lebensmittel ferner den Punkt Koexistenz: Nach dem Entwurf müssen die EU-Mitgliedstaaten regeln, dass NGT-Pflanzen nicht unbeabsichtigt in den ökologischen oder gentechnikfreien konventionellen Anbau geraten. Hier „bedarf es praxistauglicher Regeln zur Koexistenz, damit Unternehmen, die weiterhin gentechnikfrei wirtschaften wollen, hierzu auch künftig in der Lage sind“, so der BVLH. „Ob die hierfür bereits vorgesehenen Regelungselemente ausreichen, muss angezweifelt werden.“ Der Verband vermisst ferner Reglungen zum Patentrecht, die verhindern, dass NGT-Pflanzen patentiert werden können. Anderenfalls könnte „die Vielfalt und Unabhängigkeit durch das Verhalten einzelner Patentrechtsinhaberinnen und -inhaber eingeschränkt werden“. [vef]
 Aurelia-Stiftung - Handelskonzerne bei Neuer Gentechnik gespalten: ALDI und REWE für Risikoprüfung und Kennzeichnung, LIDL
Aurelia-Stiftung - Handelskonzerne bei Neuer Gentechnik gespalten: ALDI und REWE für Risikoprüfung und Kennzeichnung, LIDL
und EDEKA dagegen (08.11.2023) Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V.: Aldi für klare und umfassende Gentechnik-Kennzeichnung (08.11.2023)
Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V.: Aldi für klare und umfassende Gentechnik-Kennzeichnung (08.11.2023) Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. - Anuga 2023: Hersteller und Handel fordern Erhalt der Gentechnik-Kennzeichnung (10.10.2023)
Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. - Anuga 2023: Hersteller und Handel fordern Erhalt der Gentechnik-Kennzeichnung (10.10.2023) BVLH Handelsverband Lebensmittel: Position des Lebensmittelhandels zum EU-Verordnungsvorschlag über neue genomische Techniken COM (2023) 411 final (25.10.2023)
BVLH Handelsverband Lebensmittel: Position des Lebensmittelhandels zum EU-Verordnungsvorschlag über neue genomische Techniken COM (2023) 411 final (25.10.2023)
31.10.2023 | permalink
Crispr-Hühner: Pandemierisiko statt Gripperesistenz
 Foto: Christoph Aron / pixelio.de
Foto: Christoph Aron / pixelio.de
Britische Forschende wollten Legehennen mit Hilfe des neuen gentechnischen Verfahrens Crispr/Cas resistent gegen einen Stamm des Vogelgrippevirus machen, berichteten sie kürzlich in der Fachzeitschrift Nature Communications. Doch die Viren überwanden die Resistenz schnell und mutierten so, dass sie perspektivisch auch Menschen gefährlich werden könnten. Für die Studienautoren ist damit klar, dass diese Hühner für die Landwirtschaft nicht geeignet sind. Ein unbeteiligter Wissenschaftler nannte die Versuche eine „akademische Fingerübung“.
Um sich zu vermehren nutzt der Vogelgrippevirus in den Tieren ein Protein mit der Bezeichnung ANP32A. Die Forschenden des Edinburgher Roslin Institute und des Imperial College London änderten mit Crispr/Cas das für die Produktion von ANP32A verantwortliche Gen. Das danach produzierte ANP32A-Protein enthielt zwei andere Aminosäuren und konnte so von den Viren nicht mehr missbraucht werden, um sich zu vermehren. In Versuchen mit diesen Crispr-Hühnern zeigte sich, dass sich bei geringer Viruslast neun von zehn Hühnern nicht infizierten. Wurde die Viruslast des H2N9-Stamms auf das 1000-fache erhöht, erkrankte jedoch die Hälfte der Tiere. Ein Teil der Viren war mutiert und hatte gelernt, die verwandten Proteine ANP32B und ANP32E für ihre Vermehrung zu nutzen. Im Labor stellten die Forschenden zudem fest, dass diese Mutanten sich „unerwartet“ auch in Zellen der menschlichen Atemwege vermehren konnten und dazu die kürzeren menschlichen ANP32-Proteine nutzten.
„Das bedeutet jedoch nicht, dass veränderte Vogelgrippeviren entstanden sind, die eine neue Pandemie auslösen können“, erläuterte die Berichterstatterin der Neue Zürcher Zeitung, die selbst Molekularbiologin ist. „Sollten die veränderten Viren jedoch weiter existieren und sich in der echten Welt verbreiten, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass sie weiter mutieren – und dann irgendwann doch ein Pandemievirus entsteht.“ Auf ähnliche Weise sei vor 100 Jahren die Spanische Grippe entstanden. Den Forschenden sei dieses Risiko bewusst, schrieb NZZ-Autorin Stephanie Lahrtz. Deshalb hätten sie vor Journalisten betont, es sei ausgeschlossen, dass die von ihnen hergestellten Crispr-Hühner je in Agrarbetrieben zum Einsatz kämen.
Um das Pandemierisiko auszuschließen, schufen die Forschenden im nächsten Schritt Hühner, die gar kein ANP32A mehr bildeten, doch das schränkte die mutierten Viren nur geringfügig ein. Schließlich erzeugten sie für Laborversuche Hühnerzellen, denen alle drei ANP32-Proteine fehlten. In diesen Zellen vermehrten sich weder der ursprüngliche Virus noch die Mutationen. Auch sei es zu keinen Durchbruchsinfektionen gekommen, schrieben die Forschenden, räumten aber ein, „dass diese Kombination von Knockouts für die Gesundheit der Tiere schädlich“ sein dürfte und nichts gewonnen wäre, „wenn die erhöhte Resistenz gegen die Vogelgrippe mit einem Verlust an Fitness der Vögel einhergeht“. Um das zu überprüfen, wollen sie nach diesen Zellversuchen nun lebende Hühner ohne ANP32-Proteine entwickeln.
Timm Harder, Vogelgrippe-Experte am staatlichen Friedrich-Loeffler-Institut für Tiergesundheit, erläuterte dem Science Media Center die rechtliche Situation, falls solche Gentechnik-Tiere tatsächlich eingesetzt werden sollten: Nach europäischem Recht seien die Hühner, deren Genom mittels Crispr/Cas verändert wurde, als gentechnisch veränderte Organismen zu betrachten. „Ihre Nutzung bedürfte also einer gentechnischen Genehmigung und die Haltung wäre nach aktuellem Recht nur in einer gentechnischen Anlage möglich. Freilandhaltung wäre dann einem Freisetzungsvorhaben gleichzustellen.“ Für eine Massennutzung müssten deshalb die Gesetze entsprechend angepasst werden. Doch zuerst müssten Langzeitversuche aufzeigen, welche Effekte die abgeschalteten Gene auf die Hühner hätten. Abzuwarten bleibe zudem, „wie sich diese Hühner gegenüber den wesentlich aggressiveren, hochpathogenen aviären Influenzaviren wie H5N1 verhalten; diese wurden hier nicht getestet“. H5N1 ist der derzeit grassierende Vogelgrippe-Virus, die britischen Forschende verwendeten die weniger aggressive Variante H2N9.
Der Virologe Stephan Ludwig von der Universität Münster bezeichnete die „elegante Arbeit“ gegenüber dem Science Media Center als „Proof-of-Concept“, also als Machbarkeitsstudie, die gezeigt habe, „dass eine Gene-Editing-Strategie geeignet sein kann, um eine robuste Resistenz gegen Infektion zu erreichen“. Gleichzeitig sei aber die enorme Anpassungsfähigkeit der Viren deutlich geworden, „die bei hohen Viruslasten schon in diesen ersten Experimenten zu Durchbruchsinfektionen geführt hat“. Neben der schnellen Anpassung der Viren sieht Ludwig ebenfalls „rechtliche und ethische Hürden“ sowie das Problem einer mangelnden Akzeptanz. „Insofern ist die Arbeit zunächst einmal eine elegante akademische Fingerübung und noch weit weg von einer tatsächlichen Anwendung“, lautete sein Fazit. [lf]
 Alewo Idoko Atoh et.al.: Creating resistance to avian influenza infection through genome editing of the ANP32 gene family (Nature Communications, 10.10.2023)
Alewo Idoko Atoh et.al.: Creating resistance to avian influenza infection through genome editing of the ANP32 gene family (Nature Communications, 10.10.2023) Science Media Center: Genom-editierte Hühner gegen Vogelgrippe resistent (10.10.2023)
Science Media Center: Genom-editierte Hühner gegen Vogelgrippe resistent (10.10.2023) Neue Zürcher Zeitung: Forscher wollten ein Gentech-Huhn erschaffen, das gegen die Vogelgrippe resistent ist. Doch sie kreierten eine Brutstätte für ein gefährlicheres Virus (11.10.2023)
Neue Zürcher Zeitung: Forscher wollten ein Gentech-Huhn erschaffen, das gegen die Vogelgrippe resistent ist. Doch sie kreierten eine Brutstätte für ein gefährlicheres Virus (11.10.2023) Geo, dpa: Genveränderung soll Hühner gegen Vogelgrippe resistent machen (10.10.2023)
Geo, dpa: Genveränderung soll Hühner gegen Vogelgrippe resistent machen (10.10.2023) Infodienst: EU-Behörde: Crispr-Hühner legen nicht nur Gentechnik-Eier (04.03.2022)
Infodienst: EU-Behörde: Crispr-Hühner legen nicht nur Gentechnik-Eier (04.03.2022)
25.10.2023 | permalink
Europas Volkspartei will Gentechnik im Ökolandbau
 Europäisches Parlament / Foto: © European Union 2014 - European Parliament
Europäisches Parlament / Foto: © European Union 2014 - European Parliament
Die Europäische Volkspartei (EVP), zu der auch CDU und CSU gehören, will mit neuen gentechnischen Verfahren (NGT) hergestellte Pflanzen im Ökolandbau erlauben. Die EVP geht damit noch über Pläne der Europäischen Kommission hinaus, die zwar die Regeln für NGT insgesamt lockern, sie auf Wunsch der Biobranche für diese aber weiter verbieten will. Bioverbände protestieren gegen den EVP-Vorstoß und fordern die Europaabgeordneten auf, ihn abzulehnen. Unterdessen wird unter enormem Zeitdruck versucht, europäisches Parlament, Rat und Kommission bis Frühjahr 2024 zu einer Einigung über die neuen NGT-Regeln zu führen.
In ihrem Entschließungsantrag vom 16. Oktober schlägt die zuständige Berichterstatterin Jessica Polfjärd den Europaabgeordneten vor, NGT-Pflanzen ohne Fremdgene, für die es nach den Plänen der EU-Kommission künftig keine Risikobewertung und Kennzeichnung mehr geben soll, auch für den Ökolandbau zuzulassen. Der Verordnungsentwurf der Kommission sieht dagegen ein Verbot vor, weil die Bio-Branche Gentechnik-Pflanzen einhellig ablehnt. Eine entsprechende Resolution hatten die Delegierten des Bio-Dachverbandes Ifoam Organics Europe im Juni 2023 mit einer Mehrheit von 98 Prozent verabschiedet. Auch nach der geltenden EU-Öko-Verordnung ist Gentechnik in Bioprodukten verboten.
Kippen will die Schwedin Polfjärd auch die Vorgabe der Kommission, dass NGT-Saatgut gekennzeichnet werden muss, um Landwirt:innen die Wahl zu lassen, ob sie es anbauen wollen. Eine solche Kennzeichnung sei „diskriminierend“, heißt es zur Begründung. Schließlich will die Berichterstatterin die Regeln ändern, nach denen geprüft wird, ob es sich um eine NGT-Pflanze handelt, die vom Gentechnikrecht ausgenommen ist. Ziel ist, die Mitsprache der EU-Mitgliedstaaten zu beschränken. Auch soll die Definition von dieser Pflanzen-Kategorie so geändert werden, dass noch mehr NGT-Pflanzen darunterfallen.
Beim Thema Patente sieht die EVP dagegen keinen Handlungsbedarf. Ihr reicht es, wenn die EU-Kommission wie geplant 2026 prüft, ob zusätzliche Regelungen nötig sind. Viele dieser Punkte dürften im Sinne derer sein, die laut Resolutionsentwurf zu diesem beigetragen haben: der deutsche Saatgutkonzern KWS, der Lobbyverband Euroseeds und die schwedische Öko-Kontrollstelle Krav. Der Entwurf wird federführend im Umweltausschuss debattiert und abgestimmt, bevor er im Plenum des Europäischen Parlaments behandelt wird.
Die Biobranche ist empört über den EVP-Vorstoß: Er missachte die Sichtweise einer ganzen Bewegung und eines ganzen Wirtschaftssektors, kommentierte Jan Plagge, Präsident von Ifoam Organics Europe. Der Bio-Sektor stehe geschlossen hinter der Forderung, dass der ökologische Produktionsprozess frei von Gentechnik bleiben müsse und zwar von neuer wie alter. „Denn mit dem Vorsorgeprinzip und den Grundsätzen des ökologischen Landbaus ist diese Hochrisiko-Technologie nicht vereinbar“, sagte Plagge. Tina Andres, Vorsitzende des deutschen Biodachverbandes BÖLW mahnte, im Europaparlament werde über „die Freiheit von Bürgerinnen und Bürgern, Bauernhöfen und Unternehmen verhandelt, künftig selbst über ihr Essen oder ihre Produktion entscheiden zu können.“
Barbara Riegler, Obfrau des österreichischen Verbandes Bio Austria, sprach von einem „skandalösen Vorhaben“ und einem „Angriff auf die Bio-Landwirtschaft in Europa sowie auf den Grundsatz der Wahlfreiheit“. Alle Verbände fordern die Europaabgeordneten auf, den Vorschlag abzulehnen. Stattdessen sollten die Parlamentarier:innen sicherstellen, dass Bio gentechnikfrei bleibe und Produkte aus NGT weiterhin kontrolliert und gekennzeichnet werden sowie rückverfolgt werden können. Der Biobauer und grüne Europaabgeordnete Martin Häusling geht von harten Verhandlungen aus. Denn es gebe im Parlament keine gentechnikkritische Mehrheit, die den Vorschlag der EU-Kommission in Gänze ablehnen würde.
Parallel zur Diskussion im Parlament versucht der Europäische Rat, also die EU-Mitgliedstaaten, eine gemeinsame Position zu den NGT-Plänen der EU-Kommission zu erarbeiten. Da Befürworter wie Gegner noch zahlreiche Kritikpunkte haben, hat die spanische Ratspräsidentschaft Anfang Oktober einen Kompromissvorschlag für die Reglungspunkte eins bis elf vorgelegt. Dieser hält an einem NGT-Verbot für den Ökolandbau ebenso fest wie an einer Kennzeichnung von Saatgut der privilegierten Kategorie 1. Nur dort, wo geprüft wird, ob eine NGT-Pflanze in diese Kategorie fällt, will die Ratspräsidentschaft das Verfahren vereinfachen - allerdings nicht so weitgehend wie die EVP. Weil die Spanier unbedingt bis zum Ende ihrer Präsidentschaft im Dezember einen Ratsbeschluss erreichen wollen, stressen sie die Mitgliedstaaten mit zahlreichen, eng getakteten Arbeitsgruppensitzungen. Zur nächsten Sitzung der Agrarminister am 20. und 21. November soll auch ein Kompromissvorschlag für den Rest der Verordnung fertig sein.
Im Europaparlament will morgen der Agrarausschuss über den NGT-Entwurf der EU-Kommission debattieren. Berichterstatterin ist die tschechische Abgeordnete Veronika Vrecionová von den Europäischen Konservativen und Reformisten, deren Beschlussvorschlag dem Vernehmen nach aus Zeitgründen noch nicht schriftlich vorliegt und daher mündlich vorgetragen wird. Eine Abstimmung in diesem Ausschuss wird am 11. oder 14. Dezember erwartet. Im federführenden Umweltausschuss wird Polfjärd ihren Resolutionsentwurf voraussichtlich am 7. November vorstellen. Den Abgeordneten soll dann bis zum 15. November Zeit bleiben, Änderungsanträge einzureichen. Zusammen mit den Anmerkungen des Agrarausschusses könnte die Endfassung im Januar 2024 im Umweltausschuss abgestimmt werden. Sofern nichts dazwischen kommt, könnten nach einem Beschluss des Parlamentsplenums dann im Februar die Trilogverhandlungen mit Kommission und Rat starten - wenn letzterer bis dahin eine Position abgestimmt hat. Ziel der Befürworter:innen neuer Gentechnik ist es, die neue Verordnung zu beschließen, bevor im April 2024 der Wahlkampf fürs nächste Europaparlament beginnt. [lf/vef]
 European Parliament - Committee on the Environment, Public Health and Food Safety: draft report on the proposal for a regulation on plants obtained by certain new genomic techniques; rapporteur: Jessica Polfjärd (16.10.2023)
European Parliament - Committee on the Environment, Public Health and Food Safety: draft report on the proposal for a regulation on plants obtained by certain new genomic techniques; rapporteur: Jessica Polfjärd (16.10.2023) IFOAM Organics Europe: European Parliament should uphold ban for all NGTs in organic in rapporteur’s report (19.10.2023)
IFOAM Organics Europe: European Parliament should uphold ban for all NGTs in organic in rapporteur’s report (19.10.2023) Bioland: Inakzeptabler Vorschlag - Gentechnik hat im Ökolandbau keinen Platz! (19.10.2023)
Bioland: Inakzeptabler Vorschlag - Gentechnik hat im Ökolandbau keinen Platz! (19.10.2023) BÖLW: Gentechnik in Bundesrat und Europaparlament: Wahlfreiheit für Bürger, Betriebe und Unternehmen verteidigen! (19.10.2023)
BÖLW: Gentechnik in Bundesrat und Europaparlament: Wahlfreiheit für Bürger, Betriebe und Unternehmen verteidigen! (19.10.2023) Bio Austria: Berichterstatterin des EU-Parlaments plant Angriff auf Bio (20.10.2023)
Bio Austria: Berichterstatterin des EU-Parlaments plant Angriff auf Bio (20.10.2023) Demeter International: EU Parliament must ensure freedom of choice and maintain the ban of all NGTs in organic (19.10.2023)
Demeter International: EU Parliament must ensure freedom of choice and maintain the ban of all NGTs in organic (19.10.2023) Europäischer Rat: Regulation on new genomic techniques (NGT) – Presidency compromise text on Articles 1-11 (03.10.2023)
Europäischer Rat: Regulation on new genomic techniques (NGT) – Presidency compromise text on Articles 1-11 (03.10.2023) Das komplexe europäische Gesetzgebungsverfahren erklären wir detailliert und mit Originallinks belegt auf unserer Schwesterseite "Schule und Gentechnik"
Das komplexe europäische Gesetzgebungsverfahren erklären wir detailliert und mit Originallinks belegt auf unserer Schwesterseite "Schule und Gentechnik" Tagesordnung der Sitzung des Agrarausschusses des Europäischen Parlaments zum NGT-Entwurf der EU-Kommission am 26.10.2023
Tagesordnung der Sitzung des Agrarausschusses des Europäischen Parlaments zum NGT-Entwurf der EU-Kommission am 26.10.2023 Livestream der Sitzung des Agrarausschusses des Europäischen Parlaments zum NGT-Entwurf der EU-Kommission am 26.10.2023
Livestream der Sitzung des Agrarausschusses des Europäischen Parlaments zum NGT-Entwurf der EU-Kommission am 26.10.2023
20.10.2023 | permalink
Bundesrat bleibt bei Kennzeichnung neuer Gentechnik vage
 Bundesratsgebäude in Berlin
Bundesratsgebäude in Berlin
Die Bundesländer haben heute im Bundesrat den Vorschlag der EU-Kommission zur Regelung neuer gentechnischer Verfahren (NGT) begrüßt und nur wenig Kritisches angemahnt. Klare Ausschussempfehlungen etwa zur Kennzeichnung oder zur Möglichkeit, dass Mitgliedstaaten den NGT-Anbau verbieten können, fanden im Plenum keine Mehrheit. Das lässt der Bundesregierung viel Freiheit für ihre Verhandlungen in Brüssel.
Der Bundesrat betonte das Potential von NGT-Pflanzen für Forschung und Pflanzenzüchtung und lobte die EU-Kommission dafür, dass sie eine Regulierung anstrebe, „um die mit der Entwicklung und dem Anbau von NGT-Pflanzen verbundenen Chancen für eine nachhaltige Landwirtschaft auch in der EU nutzen zu können“. Doch werfe der Vorschlag „noch Fragen hinsichtlich Transparenz, Wahlfreiheit, Koexistenz sowie des Vorsorgeprinzips auf“.
In der Beschlussvorlage hatten seine Ausschüsse dem Bundesrat deutliche Worte empfohlen, etwa: „Eine Kennzeichnungspflicht aller NGT-Pflanzen und daraus hergestellten Produkte ist durchgängig auf allen Stufen vom Erzeuger bis zum Verbraucher zu gewährleisten“. Oder: „Die Wahlfreiheit für Verbraucherinnen und Verbraucher ist nach Auffassung des Bundesrates ein sehr hohes Gut und schafft Vertrauen“. Diese Formulierungen fanden in der Plenarabstimmung keine Mehrheit und verschwinden damit aus dem Text. Ebenso gestrichen wurde die Bitte an die Bundesregierung, „sich dafür einzusetzen, dass es Mitgliedstaaten weiterhin ermöglicht wird, regional begrenzte Opt-Out Regelungen für den Anbau von NGT-Pflanzen zu nutzen“. Eine solche Möglichkeit, dass Mitgliedstaaten den Anbau von NGT-Pflanzen aus Koexistenzgründen verbieten können, hatte die EU-Kommission in ihrem Vorschlag explizit ausgeschlossen.
Erhalten blieb die Formulierung, dass der Bundesrat die Auswirkungen des Verordnungsvorschlags auf den Ökolandbau „mit großer Sorge“ betrachte. Er will deshalb erreichen, dass Maßnahmen wie Abstandsregelungen und Mitteilungspflichten gegenüber den Nachbarn für den Anbau von NGT-Pflanzen weiterhin vorgeschrieben werden. Außerdem seien Öko-Erzeuger und -Verarbeiter „bei festgestellter unbeabsichtigter Beimischung oder Verunreinigung von einer Haftung zu befreien“.
Beim Thema Patente blieb es beim ursprünglichen Text. Damit Züchter ungehindert mit NGT-Pflanzen arbeiten können, soll die Bundesregierung die weiteren Verhandlungen im EU-Ministerrat daran koppeln, „dass parallel seitens der Kommission geprüft wird, welche Auswirkungen Patente auf NGT-Pflanzen auf den Saatgutmarkt hätten und ob eine Änderung des Patentrechts erforderlich ist“. Außerdem „sollte klargestellt werden, dass die Verwendung von zufälligen Mutationen und natürlichen Genvarianten im Rahmen der konventionellen Züchtung nicht durch Patente eingeschränkt werden darf“.
Keine Mehrheit gab es in der Länderkammer für die abschließende Bemerkung „Im Übrigen bittet der Bundesrat die Bundesregierung, sich bei den Verhandlungen auf EU-Ebene dafür einzusetzen, das Vorsorgeprinzip zu wahren, da es sich bei NGT um eine Technologie mit hoher Eingriffstiefe und mangelnder Umkehrbarkeit aus den Öko-Systemen handelt.“ Wie die einzelnen Bundesländer abgestimmt haben, teilt der Bundesrat grundsätzlich nicht mit.
Im Vorfeld hatten Verbände der konventionellen und ökologischen Agrarwirtschaft eindringlich an die Länderkammer appelliert, sich gegen die Pläne der EU-Kommission zu wenden, die Regeln für neue gentechnische Verfahren zu lockern. „Der Gesetzentwurf der EU-Kommission zielt auf eine radikale Abschaffung von Risikoprüfung und Kennzeichnung ab, für fast alle mit neuen Gentechniken entwickelten Pflanzen“, warnte etwa die Vorsitzende des Bundes ökologische Landwirtschaft, Tina Andres. Damit rolle die EU-Kommission „der Konzern-Lobby den roten Teppich aus – obwohl deren absurde Heilsversprechen für NGT-Pflanzen bisher überhaupt nicht belegt sind“. Das stehe im Widerspruch zum „klaren Wunsch einer überwältigenden Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, der landwirtschaftlichen Betriebe und Lebensmittelunternehmen …, die auch künftig ohne Gentechnik-Zwang produzieren und essen wollen“.
Auch die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) kritisierte, dass der Verordnungsentwurf vor allem Konzerninteressen diene. Die gentechnikfreien Märkte in Deutschland und Europa seien ein Wettbewerbsvorteil, der diesen Interessen nicht geopfert werden dürfe, mahnte AbL-Expertin Annemarie Volling. Sie erinnerte die Ländervertreter:innen daran, dass sie dafür verantwortlich sind, Agrarprodukte auf unzulässige Gentechnikbestandteile zu kontrollieren. „Selbstredend brauchen wir Kennzeichnungspflicht entlang der gesamten Lebensmittelkette, verpflichtende Nachweisverfahren und Referenzmaterial sowie Rückverfolgbarkeit und Rückholbarkeit“, so Volling.
Einige Verbände hatten vorab auch Beschlussempfehlungen an die Mitglieder des Bundesrats versandt. So hatte die Aurelia-Stiftung sich - erfolgreich - dafür eingesetzt, dass der Bundesrat sich für einen Haftungsausschluss ausspricht, wenn fremde Gentechnikpflanzen Honig oder andere Produkte der gentechnikfreien Landwirtschaft unbeabsichtigt verunreinigen. Am liebsten wäre es den Bienenschützern aber gewesen, die Länderkammer hätte den kompletten Verordnungsentwurf abgelehnt. [lf/vef]
 Bundesratsitzung v. 20.10.2023: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/625 (mit Beschlusstext und Video)
Bundesratsitzung v. 20.10.2023: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/625 (mit Beschlusstext und Video) Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft - Gentechnik in Bundesrat und Europaparlament: Wahlfreiheit für Bürger, Betriebe und Unternehmen verteidigen! (19.10.2023)
Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft - Gentechnik in Bundesrat und Europaparlament: Wahlfreiheit für Bürger, Betriebe und Unternehmen verteidigen! (19.10.2023) Medieninfo der AbL zur Bundesratsitzung: Gentechnikfreie Lebensmittelerzeugung sichern! (20.10.2023)
Medieninfo der AbL zur Bundesratsitzung: Gentechnikfreie Lebensmittelerzeugung sichern! (20.10.2023) Brief der Aurelia-Stiftung an alle Bundesratsmitglieder: Empfehlungen zur Bundesratsbefassung zur vorliegenden Empfehlungsdrucksache 328/1/2023 (12.10.2023)
Brief der Aurelia-Stiftung an alle Bundesratsmitglieder: Empfehlungen zur Bundesratsbefassung zur vorliegenden Empfehlungsdrucksache 328/1/2023 (12.10.2023)
*** Unterstützen Sie unsere Arbeit ***
Alle Informationen auf dieser Seite sind für Sie kostenlos, kosten aber trotzdem etwas. Unterstützen Sie den Infodienst - damit es auch weiterhin kritische Informationen zum Thema Gentechnik für alle gibt!![]() Spenden-Infos hier
Spenden-Infos hier
Newsletter bestellen
Infodienst-Material


Hier bekommen Sie kostenloses Infomaterial zum Thema: Flyer, Postkarten, Newsletter, Newsticker...![]() Bestellung
Bestellung


